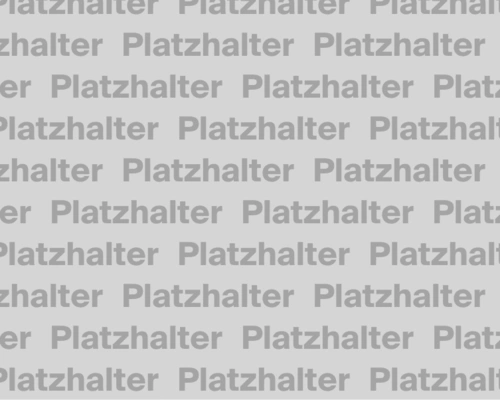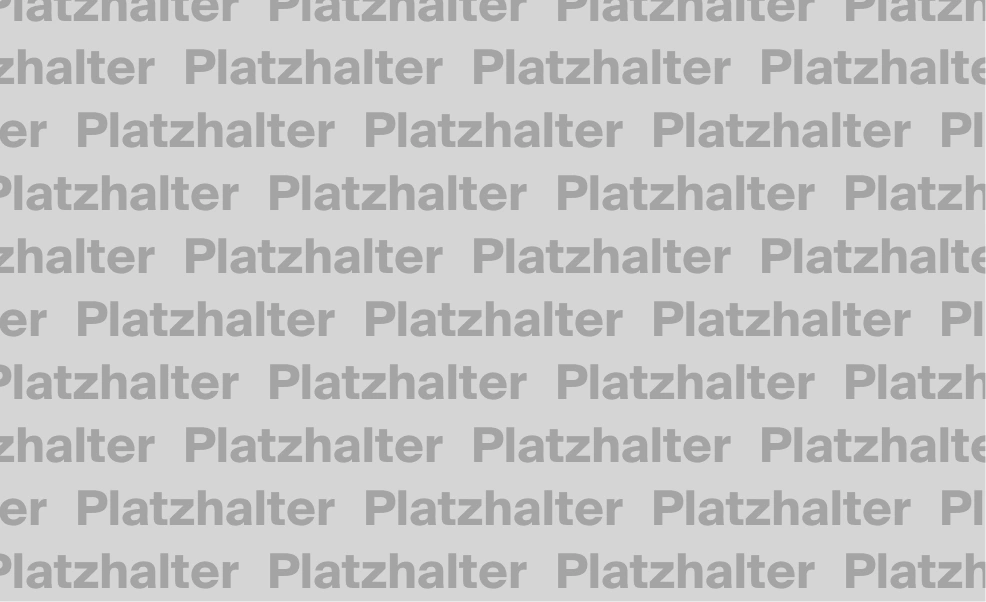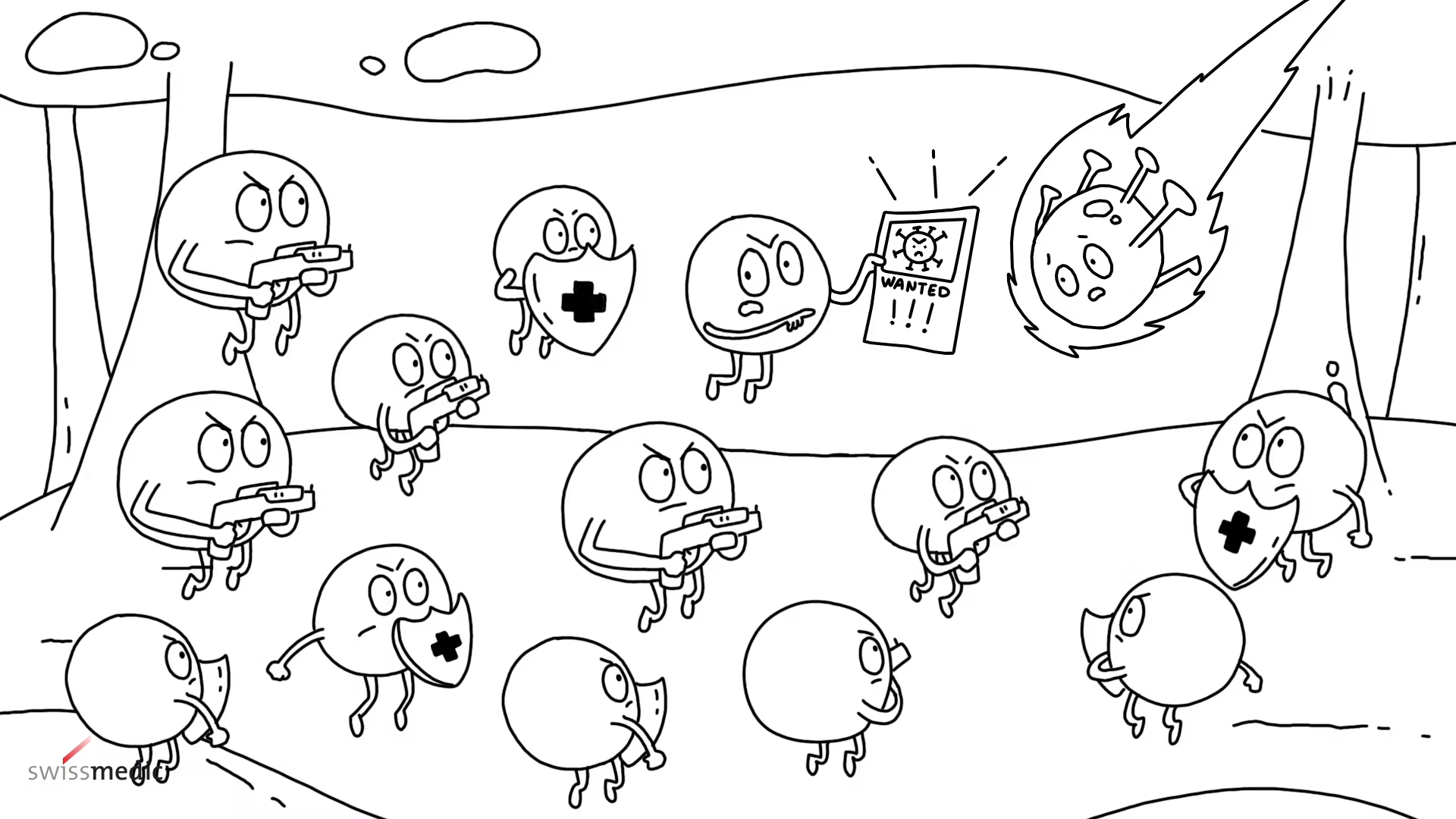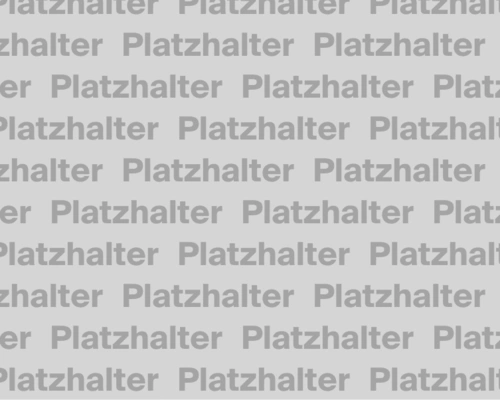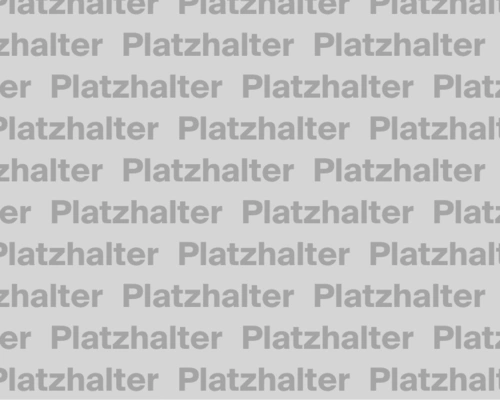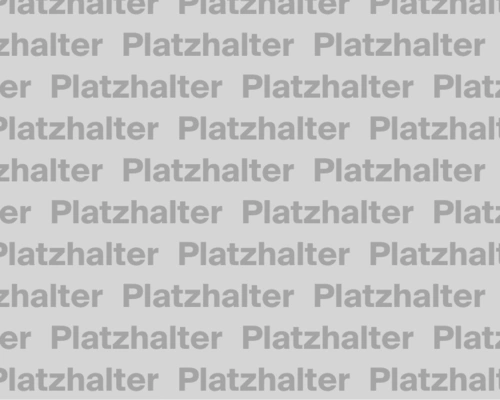Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen, ist komplex und aufwändig. Die Anforderungen an die Qualität, die Wirksamkeit und insbesondere die Sicherheit sind hoch. Deshalb muss die Entwicklung eines Impfstoffes unterschiedliche Phasen durchlaufen. Nur wenn eine Phase gute Ergebnisse zeigt, kommt der Impfstoff in die nächste Phase der Weiterentwicklung.
Phasen der Entwicklung:
1. Vorklinische Phase
Der Impfstoff wird im Labor und an Tieren getestet.
2. Klinische Phase
Die klinische Erprobung unterteilt sich in drei Phasen:
Klinische Phase I:
An einer kleinen Zahl von gesunden Freiwilligen wird erstmals geprüft, wie der Mensch auf den Impfstoff reagiert und wie verträglich verschiedene Dosierungen sind. Dosierung heisst, wie oft und mit welcher Menge geimpft wird. In dieser Phase können auch erste häufig auftretende Nebenwirkungen erkannt werden.
Klinische Phase II:
In dieser Phase wird der Impfstoff an mehreren hundert Freiwilligen geprüft. Dabei zeigt sich, ob der Impfstoff die gewünschte Immunantwort auslöst und welche Dosierung optimal ist. Zudem werden Erkenntnisse über die Häufigkeit und den Schweregrad von möglichen Nebenwirkungen gesammelt.
Klinische Phase III:
Nun wird der Impfstoff an mehreren tausend Freiwilligen getestet. In dieser Phase wird die Immunantwort weiter untersucht und es wird geprüft, ob der Impfstoff auch tatsächlich vor der Krankheit schützt. Zudem werden seltene Nebenwirkungen und Risiken erkannt. Es wird ausserdem überprüft, für welche Alters- oder Bevölkerungsgruppen der Impfstoff eingesetzt werden kann.
Zulassungsverfahren:
In der Schweiz ist Swissmedic für die Zulassung zuständig und entscheidet, ob ein Impfstoff zugelassen wird.
Wenn der Impfstoffhersteller ein Zulassungsgesuch einreicht, werden in einem nächsten Schritt alle vorliegenden Ergebnisse der klinischen Phasen I – III sowie alle nicht-klinische Studien und Qualitätsaspekte durch Swissmedic überprüft. Kann Swissmedic die Wirksamkeit, die Sicherheit und die Qualität des Impfstoffes bestätigen, erteilt sie die Marktzulassung für die Schweiz.
Ist ein Impfstoff zugelassen, wird vom Bundesamt für Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF eine Impfempfehlung für die Bevölkerung ausgesprochen. Eine Impfung wird nur empfohlen, wenn der Nutzen durch verhinderte Krankheiten und deren Komplikationen die mit den Impfungen verbundenen Risiken deutlich übertrifft.
3. Folgestudien (Phase IV)
Auch nach der Zulassung müssen Impfstoffhersteller die Sicherheit, die Wirksamkeit und die Qualität weiterverfolgen. Die Hersteller prüfen laufend, ob seltene oder schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten und melden diese Swissmedic. Ebenfalls wird die Verträglichkeit des Impfstoffes in Bevölkerungsgruppen geklärt, welche in vorhergehenden Studien nicht nicht beobachtet wurden
Weitere Informationen erhalten Sie hier: